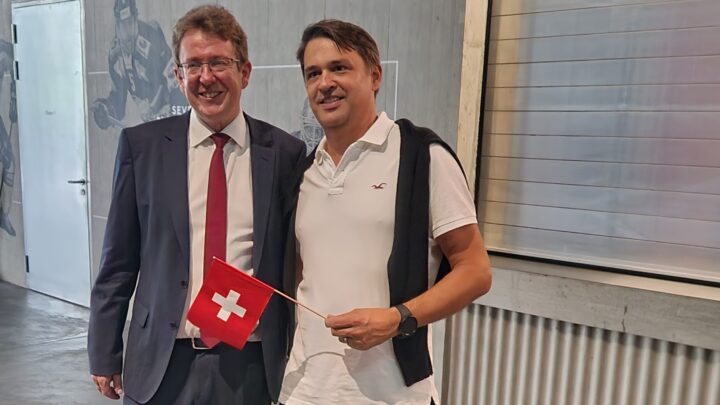Fehlende Ämterbereitschaft führt zu Gemeindefusionen
Die fehlende Ämterbereitschaft führt zu Gemeindefusionen, ein finanzielle Vorteil löst sich bei Fusionen ohnehin meist in Luft auf. Doch Gemeindefusion hin oder her, im Kanton Zürich gäbe es Potential die Organisation zwischen der kantonalen und kommunalen Ebene einer Effizienzsteigerung zu unterziehen, ohne gleich die Gemeindeautonomie aufzugeben.

Der wahre Grund für Gemeindefusionen liegt nicht bei den finanziellen Vorteilen, welche sich nach einer Fusion meist ohnehin in Luft auflösen. Gemeindefusionen drängen sich auf, weil in der Bevölkerung immer weniger Bereitschaft vorhanden ist, ein Exekutivamt zu übernehmen. Dazu fehlen in kleinen Gemeinden oft die politisch aktiven Parteien. Denn je grösser die Gemeinden, desto mehr streiten sich die politischen Parteien um die Besetzung der Exekutivämter und rekrutieren Kandidatinnen und Kandidaten. Wie im Artikel erwähnt sei eine Gemeinde mit 3000 Einwohner nach einer Gemeindefusion immer noch zu klein, um eine Effizienzsteigerungen auszuweisen. Dies mag vielleicht im Vergleich im Kanton Zürich stimmen. Hier haben die 160 Gemeinden (ohne Stadt Zürich) im Durchschnitt fast 7’000 Einwohner. Einen Vergleich mit den 338 Gemeinden im Kanton Bern zeigt, dass dort eine Gemeinde im Durchschnitt 3’000 Einwohner hat und der Kanton viel kleinräumiger organisiert ist. Bei der im Kanton Zürich angestrebten Einwohnerzahl pro Gemeinde könnte man die Hälfte der Gemeinden im Bezirk Dielsdorf auflösen. Durchaus Potential zur Effizienzsteigerung liegt aber in der Aufgabenerfüllung zwischen Kanton und Gemeinden. Viel zu oft befiehlt heute eine Ebene und die andere bezahlt. Deshalb, Gemeindefusion hin oder her, im Kanton Zürich gäbe es Potential die Organisation zwischen der kantonalen und kommunalen Ebene einer Effizienzsteigerung zu unterziehen, ohne gleich die Gemeindeautonomie aufzugeben.
Fabian Schenkel, Hüttikon